Das Kollektive Fotoalbum - Mit anderen Augen
Brüder


Bruder & Schwester


Camping


Das Reich der Frau


Die Fahrt


Dressuren


Familie


Freundinnen




Geschwister


Großeltern




Kind mit Geschenk

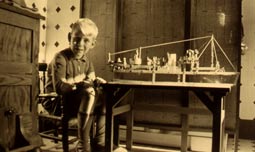
Kleinkind
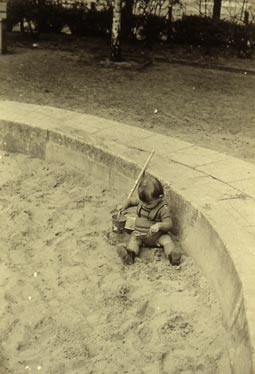



Kleinkind mit Elternteil


Leiden und Genesung


Männer unter sich


Mit Auto


Paare


Schulanfang


Trophäen


Umzug


Und Tiere

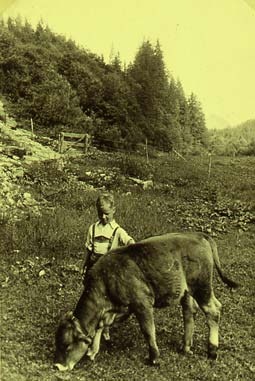


Weihnachten

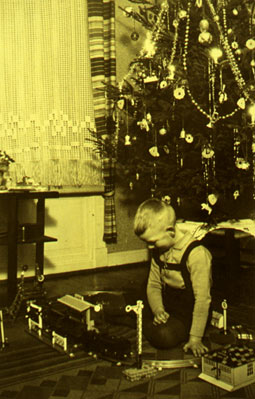


Dr. Theo Waindrukh, Psychiater: Vom Fremden zum Ureigenen
(Das „Kollektive Foto–Album“ vom Hans Bunge)
„Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen (aber wenige erinnern sich daran)“
Saint – Exupéry, Der kleine Prinz
„Re-search is me-search“ hat mal ein Psychiater gesagt (1). Eine gute Illustration dieser These ist für mich das „Kollektive Fotoalbum“ von Hans Bunge geworden.
+ + +
1975 bekommt Hans Bunge, damals noch Kunststudent, ein Examensthema: Er
soll am Material seiner Familienfotos eine Biographie komponieren.
Hans Bunges Kindheit fiel in die frühe Nachkriegszeit mit persönlich erlebter
Landteilung, sein Studium in die Zeit der Studentenbewegung und der Kritik
der bürgerlichen Psychologie, er selbst gehört zur Generation der 68er: Es
könnte eine interessante pictorial autobiography werden.
Hans Bunge kann aber mit seinem Familienalbum wenig anfangen: Er habe sich
zwar auf den Fotos gesehen, habe aber nicht das Gefühl, es seien seine Bilder
- die anderen hätten „mit deren Fotoapparat Besitz von mir ergriffen“. So
werfe er diese Fotos, in einem Schuhkarton verpackt, auf den Müll.
„Zeitgleich“ - so Hans Bunge - „rückten andere Fotos in mein Blickfeld“.
Fotos unbekannter Herkunft, die er auf dem Sperrmüll fand und sich auf Flohmärkten
und Trödelläden zusammensuchte und dann reproduzierte.
So ist eine Bildsammlung entstanden. Ein Teil der Fotos blieb nach der Reproduktion
authentisch. Die anderen wurden später digital verarbeitet und in ihrer Komposition
„minimal“, aber wirklich minimal verändert, besser ausgedrückt „ergänzt“,
so dass einige eigenartige Werke entstanden sind, die höchste Ansprüche auf
Zusammenwirkung der Wahrnehmung und Kognition des Zuschauers stellen (2).
Von den „ungekünstlicht“ gebliebenen Bilder präsentiert Hans Bunge heute
nur eine Auswahl, die allerdings einen tiefen Einblick in die Kultur- und
Psychobiographie einiger Generationen bieten.
Mich hat Hans Bunge gebeten, hierüber einiges von dem zu erzählen, was einem
Psychiater zu dieser Auswahl einfällt.
Selbst diese Auswahl ist sehr vielseitig und umfangreich, so dass ich von
vielen Themen nur bei einem bleibe, das mich besonders bewegt hat, nämlich:
Die Kindheit und das Kind in der Familie.
+ + +
Es war 1975, als Hans Bunge seine eigenen Fotos wegwarf.
In diesen Jahren kommen viele Psychoanalytiker zur Einsicht, die Künstler
uns schon längst zu vermitteln versuchten und die B. Chatwin eindrucksvoll
„... die Zivilisation wurde mit Peitschenhieben ins Leben gerufen. Wir
erleben die Last“ (3) und A. Mitscherlich als „...Erziehung zwangläufig
auf eine vom Kind als sinnlos erlebte Frustration hinausläuft...“ (4) beschrieben
hatten. Auch dem breiten Publikum werden langsam diese Gedanken zugänglich:
in Vorbereitung ist die deutsche Übersetzung eines Buches (5), das 5 Jahre
später unter dem Titel „Hört ihr die Kinder weinen“ erscheint. Selbst die
psychologischen Bedürfnisse und Schwierigkeiten der in Unfreiheit aufziehenden
Primaten, aber auch anderer Säugertiere, gewinnen in diesen Jahren langsam
Anerkennung (6).
Zu denen, die die Folgen ihrer „Erziehungsfrustration“ entweder noch auszulöffeln
hatten (wie J-P. Sartre) oder längst gestorben sind, bevor sie es schaffen
konnten (wie F. Nietzsche, F. Kafka, um nur einige zu nennen) reiht sich
eine Psychoanalytikerin ein, Alice Miller, die Mitte der siebziger Jahre
gerade versucht, eigene Folgen dieser kindlichen Frustrationen analytisch
zu überwinden. Es wird noch etwas dauern, bis sie aus einer erneuten Frustration
heraus ihre Tätigkeit als Analytikerin aufgibt, um einen anderen (Aus)Weg
zu suchen.
Sollte man annehmen, dass sich Hans Bunge 1975 auch in der Gesellschaft derer
befand, denen ihre Familienfotos nicht unbedingt nur Freude bereiteten?
Sicher ist aber, dass 1985, als Alice Millers „Bilder einer Kindheit“ erschien
(7), war Hans Bunge schön längst dabei, seine Kindheit, sein Leben und sich
selbst aufs neue zu erleben, allerdings nicht wie A. Miller mit einem Pinsel
in der Hand, sondern in seiner Dunkelkammer im Spiegel unzähliger fremder
Bilder.
Heute könnte er die Worte von Alice Miller seine eigenen nennen: „... es
kam sehr zaghaft, sprach zu mir sehr undeutlich, nahm mich an der Hand und
führte mich in Räume, die ich mein Leben lang gemieden hatte und die mir
Angst machten“.
Wie gelingt es diesem „es“, das Verbot eines „Blaubartes“ zu umgehen, den
Zugang zu „Schreckenskammer“ zu schaffen und dabei noch einen affektiven
Gewinn zu erzielen, der oft unerreichbares Ziel einer oder mehrerer langfristiger
analytischer Therapien bleibt?
Ist es eine „Selbstkunsttherapie“ gewesen?. Wie man es auch nennt: Hans Bunges
Erfahrungen sind so originell, dass, hätte ich das 1981 erschienene Werk
der innovativsten und „außergewöhnlichsten“ Psychotherapieverfahren (8) heute
herausgegeben, hätte ich es mit diesen Erfahrungen ergänzen wollen.
Die Frage, ob Hans Bunges kognitiver und emotionaler Gewinn für ihn das Wichtigste
geworden oder ein Nebenprodukt seiner künstlerischen Arbeit geblieben ist,
könnte wahrscheinlich er selbst nicht eindeutig beantworten.
Wichtig aber ist, dass die Ergebnisse seine Arbeit, ungeachtet ihrer künstlerischen
und kulturhistorischen Einschätzung, viel allgemeinere Bedeutung haben, vor
allem für die so genannte Life – Event – Forschung, einer in den 20-er Jahren
in Berlin entstandenen Methode der psychoanalytisch orientierten biographischen
Forschung und auch für die “KAF“ (Kollektive – Autobiografie - Forschung
(siehe u. a. 9-11). Sind diese beiden Forschungsmethoden aber an die Sprache
und – insbesondere die erste - an die analytische Grundsätze gebunden, bietet
Hans Bunges „kollektive Bildbiographie“ einen unverstellten und unmittelbaren
Einblick in die Familiendynamik und in den Platz des Kindes in der Familie,
so dass man mit jedem Bild wieder und wieder miterlebt, wie „...die affektiven
Bedürfnisse der Eltern die „Rolle“ des Kindes in der Familie bestimmen“ (13).
So gesehen können die Bilder des Kindes als eines Objektes vor der Kamera
wohl einiges besser vermitteln, als ein analytisches Interviews, das die
„Schweigermauer“ (14) nicht so leicht zum Abbruch bringt.
+ + +
Waren es eigens gemalte Bilder, in denen Alice Miller „die bisher verdrängten Gefühle (der) Kindheit ...(auf) tauchten“, sind es fremde Bilder einer „kollektiven Kindheit“ geworden, die Hans Bunge zu seiner eigenen verhalfen.
+ + +
Ich versuche Hans Bunge bei seiner Arbeit in seiner Dunkelkammer vorzustellen.
Dabei fallen mir die Abenteuer einer anderen Alice ein, die Lewis Caroll
hinter einen Spiegel schauen ließ (15).
Langsam lassen sich unter der Fläche der sich bewegenden Entwicklerbrühe,
wie in einem Spiegel, schwankende Konturen eines Bild erkennen, als würde
sich ein Schleier lüften. Die karge rötliche Beleuchtung der Kammer und der
erwartungsvolle, anstrengende Blick des Repro - Fotographen verleihen der
Situation eine besondere Spannung.
Die „Sichtbarwerden“ und noch mehr „Sichtbarmachen“ hat immer was spannendes
und magisches in sich. In der abendländischen Geschichte wird der Versuch
der Sichtbarmachung eher einer Antigestalt zugeschrieben (16). Um die verzaubernde
Wirkung des Sichtbarmachens wusste schon Guy de Maupassant, der in seinen
Novellen die Frauen langsam entkleidete. Spätestens aber seit der Verhüllungen
von Christo und Jeanne-Claude konnte man erlebten, dass eine Verhüllung „eine
Befreiung von Historie und Wirklichkeit“ bewirkt, die Wahrnehmung schärft
und den Gegenstand „noch präsenter“ werden lässt (16).
In der Dunkelkammer von Hans Bunge könnte diese langsame „Entfaltung“ des
Bildes einen „Spiegeleffekt“ herbeiführen, der wiederum eine „Wunderkette“
auslöste.
Das Spiegelbild, ja selbst der Blick in den Spiegel hat schon immer Mensch
und auch manches Tier fasziniert und, wenigstens beim Mensch, zum Phantasieren
verleiht. Der Glaube, man kann dem Spiegel Geheimnisse entlocken, scheint
eine ewige Geschichte zu haben. „Die Rückseite des Spiegels“ – so betitelte
Konrad Lorenz sein Buch über die Geschichte menschlichen Erkennens (17).
Nicht nur Erkennen kann aber hinter einem Spiegel stecken, auch Verkennen.
Der Spiegelbild kann in seinen Bann zwingen, man kann sich in seinen Spiegelbild
nicht nur verlieben, sondern sich in diesem verlieren. Die Spiegelbezogenen
Aberglauben sind auch heute nicht ausgestorben.
im spiegel siehst du
dich mit geschlossenen augen
in versuchung zu versuchen
den sandkornkern wahrheit
in den sandburgen deiner phantasie
aus den augen zu verlieren
nicht aus den augen zu reiben
in keinen spiegel zu treiben
ist nicht leicht
mit geschlossenen augen
Was verleiht denn dem Spiegel diese Faszination?
Auf die Ursprünge der menschlichen Identität, des „Ich“ kommend, spricht
der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan vom „Spiegelmenschen“ (18).
Sein Spiegelbild übe auf ein Kind so große Faszination nicht weil es seine
bereits vorhandene Identität bestätige, sondern weil es diese erst konstituiere.
Und zwar weil dieses Bild „anders“ sei, „dem Kind heterogen“ und „entfremdend“
wirke und das Kind zu Identität mit etwas Fremden führe. Der Weg zu sich
selbst führe über täuschend bekannte Fremde. Diese „Täuschung“ wiederhole
sich immer wieder auch im Erwachsenenleben, weil auch ein Erwachsene im eigenen
Spiegelbild zuerst was fremdes sieht, um dann sich als sich zu erkennen.
Es muss eine „Demarkationslinie“ geben, die zwischen dem Betrachter und ihm
im Spiegel entgegenstrebendem Bild liegt und seine Identität sichert.
Ich kann mir gut vorstellen, dass in der „magischen“ Situation der Dunkelkammer
diese Linie sich lockert, so dass das eigene Bild mit Spiegelbild eines fremden
verschmilzt.
Dabei spielen auch die „allzu menschlichen“, wieder erkennungsfähigen Bildsituationen
eine große Rolle, von denen Hans Bunge selbst als von „bildimmanenten Beziehungsstrukturen“
spricht.
Gerade das „Bildimmanente“, Allgemeingültige der Situation und deren „Neutralität“
ist es offensichtlich, was die eigenen Widerstände umgehen lässt, um den
Weg zu den ureigenen Bildern zu finden, die sich sonst hinter der „Schweigermauer“
der abgespaltenen Gefühle verbergen.
Die sich irgendwann zu den im Gedächtnis auftauchenden eigenen Bilder aufgebaute
Gefühlsperre wird aufgehoben, situationsähnliche eigene Bilder werden wieder
erkannt (oder auch verkannt?), der früher abgespaltete Affekt wird erlebt,
befreit und zugelassen. Die Mauer bricht ein.
+ + +
Aus der hier präsentierten Bildauswahl lassen sich nicht unbedingt eindeutige
Rückschlüsse auf die persönliche Biographie des Autors ziehen. Es bleibt
immer noch eine „kollektive“ Bildbiographie, die Hans Bunge uns zeigt. Als
solche ist sie wiederum selbstverständlich auch Teil seiner eigenen.
Es ist doch erstaunlich, „was Alltagsfotos erzählen können“ (20).
„... wie das Wort als Mittel zur Einung der Menschen dient, so auch die Kunst. Die Besonderheit jedoch, die dieses Kommunikationsmittel von der Kommunikation durch das Wort unterscheidet, besteht darin, dass der Mensch durch das Wort einem anderen seine Gedanken vermittelt, durch die Kunst aber die Menschen ihre Gefühle vermitteln“ (L. Tolstoi, 12)
+ + + alexander geimer
man denke nur daran, dass “it is surprisingly easy to implant false memories
into one quarter of people - and if you can be bothered to fake up a picture
to go with the memory, you can increase that fraction to two-thirds of people”
(© Karl S. Kruszelnicki Pty Ltd 2004. More 'Great Moments'. Home ©2004 ABC)
allerdings sollte man nicht vergessen, dass „ kein Schaffender zu hoch steht, um nicht Objekt der Forschung zu sein. Das ist der Tribut an die Allgemeinheit, an die jeder Einzelne kraft der sozialen Basis alles Menschlichen gekettet ist; und von ihm kann ihn niemand jemals entbinden“ (19)